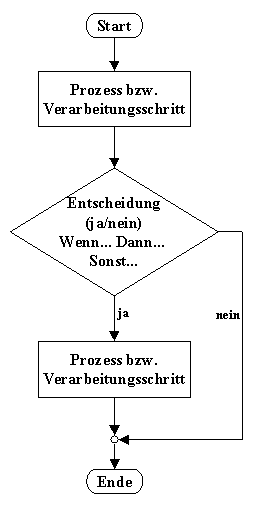
Ein Bild sagt mehr, als tausend Worte. Zumindest
manche Bilder. Der Prozessfluss ist jedenfalls sofort sichtbar und man
muss nicht unbedingt mehrere Kapitel für alternative Abläufe
schreiben, wie dies beim strukturierten Deutsch der Fall ist. Ein
großer Vorteil ist, dass man nicht versehentlich
unvollständige
Prozesse darstellt: Im Bild würde eine fehlenden nein-Verzweigung
bei der Entscheidung selbst bei oberflächlicher Betrachtung sofort
auffallen und hinterfragt werden, wie der Prozess dann fortgesetzt wird.
Wenn Fachanwender zum ersten Mal ein Flussdiagramm sehen, kriegen sie meist einen Schreck. Der Analytiker sollte sich also zuerst erkundigen und dann wenn nötig die Darstellungselemente erklären und einen exemplarisch Prozess zusammen mit dem Fachanwender durchspielen.
Flussdiagramme sollten auch nicht überfrachtet werden. Hat man mehr als drei Entscheidungen in einem Ablauf, dann wird das Bild unübersichtlich und passt wahrscheinlich nur noch schwer auf eine Seite.
Im Rahmen eines Anforderungsdokuments sollte das Flussdiagramm auch nur für die Darstellung einer abstrakten Sicht auf den Prozess benutzt werden und nicht für einzelne Abläufe auf dem Niveau, das ein Programmierer anstrebt. Ein Prozess kann also einfach nur "Prüfung der Eingabe" heißen, und die anschließende Entscheidung "Eingabe korrekt?". Die Prüfung selbst muss natürlich außerhalb des Flussdiagramms dargestellt werden, z.B. durch strukturiertes Deutsch.
Wenn Fachanwender zum ersten Mal ein Flussdiagramm sehen, kriegen sie meist einen Schreck. Der Analytiker sollte sich also zuerst erkundigen und dann wenn nötig die Darstellungselemente erklären und einen exemplarisch Prozess zusammen mit dem Fachanwender durchspielen.
Flussdiagramme sollten auch nicht überfrachtet werden. Hat man mehr als drei Entscheidungen in einem Ablauf, dann wird das Bild unübersichtlich und passt wahrscheinlich nur noch schwer auf eine Seite.
Im Rahmen eines Anforderungsdokuments sollte das Flussdiagramm auch nur für die Darstellung einer abstrakten Sicht auf den Prozess benutzt werden und nicht für einzelne Abläufe auf dem Niveau, das ein Programmierer anstrebt. Ein Prozess kann also einfach nur "Prüfung der Eingabe" heißen, und die anschließende Entscheidung "Eingabe korrekt?". Die Prüfung selbst muss natürlich außerhalb des Flussdiagramms dargestellt werden, z.B. durch strukturiertes Deutsch.